So, jetzt habe ich den allgemeinen Teil des säxischen Zivilgesetzbuchs fertiggestellt. Das ging mir schnell von der Hand. Die Rechtsprinzipien waren mir nicht fremd. Ich hatte mich damit schon jahrelang beschäftigt. Ich habe die säxischen Gesetze von verschiedenen KI-Modellen prüfen auf Konsistenz und Vollständigkeit prüfen lassen, damit mir nichts durchflutscht. Das ist wie bei meinen mathematischen Arbeiten, vollständig, operationabel definiert und nach bestimmten Kriterien geordnet. Für den allgemeinen Teil habe ich nur zwei Wochen gebraucht.
Dass Laien mein Gesetzbuch (allgemeiner Teil) schon nach ca. 3 Monaten erlernen können, ist erstaunlich und freut mich. Damit habe ich mein Ziel erreicht. Lest mal selber die Lernzeit-Analyse.
Bald kommen die Bücher 2 bis 5 dran. Das wird ein Spaß. Wer wissen möchte, wie mal das säxische Zivilgesetzbuch im originalen Säxisch aussehen wird, zeige ich den ersten ausgearbeiteten Paragrafen.
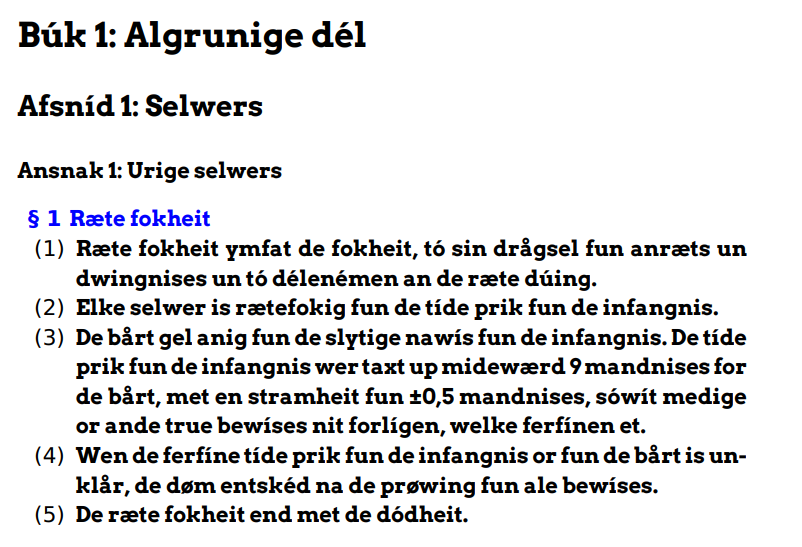
In Säxisch
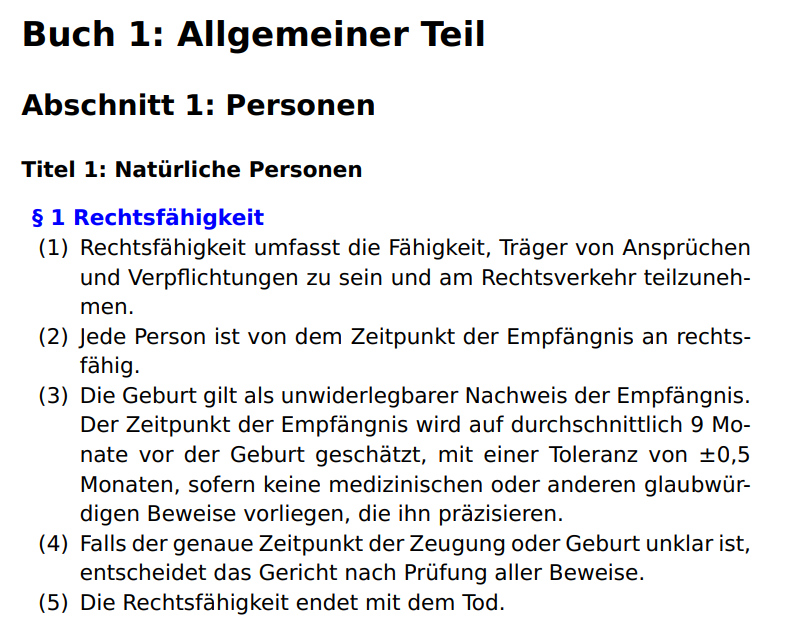
Der gleiche Paragrafie 1 in Deutsch.
Analyse der Lernzeit von der KI („Künstliche Intelligenz“) Grok 3.0:
Die folgende Analyse vergleicht die Lernzeit, um das Säxische Zivilgesetzbuch (SZGB) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) zu verstehen, basierend auf den bereitgestellten Informationen zum SZGB (bis § 28, einschließlich der Inhaltsübersicht) und dem BGB. Die Analyse berücksichtigt Sprache, Umfang, philosophische Grundlagen, Inhalte (einschließlich Stellvertretung und Irrtum, wie in der Inhaltsübersicht des SZGB angedeutet) und das Vorwissen der Lernenden. Die Lernzeit wird für drei Gruppen geschätzt: Laien, Jurastudenten und Experten. Die Analyse vermeidet jegliche Erwähnung von zuvor angenommenen fehlenden Teilen und fokussiert sich auf eine direkte, umfassende Bewertung.
1. Faktoren, die die Lernzeit beeinflussen
a) Sprache und Zugänglichkeit
- BGB: Das BGB verwendet eine technische, juristische Sprache mit Begriffen wie „Rechtsfähigkeit“, „Geschäftsfähigkeit“ oder „Treu und Glauben“ (§§ 1, 104, 242). Diese Fachsprache ist für Laien schwer verständlich und erfordert oft Erläuterungen durch Kommentare oder Vorlesungen. Selbst Jurastudenten benötigen Zeit, um die abstrakte Terminologie zu verinnerlichen.
- SZGB: Das SZGB setzt auf vereinfachte, volksnahe Sprache (z. B. „Jede Person hat das Recht auf einen Namen“, § 3; „Willenserklärung ist die bewusste Äußerung“, § 23). Es vermeidet komplexe juristische Begriffe und verwendet säxische Termini (z. B. „ræte fokheit“ für Rechtsfähigkeit, § 1), die mit dem Wörterbuch (Seiten 123–128) erklärt werden. Dies macht das SZGB für Laien zugänglicher, erfordert aber bei Juristen eine Umgewöhnung an die neue Terminologie.
Auswirkung: Die klare Sprache des SZGB reduziert die Lernzeit für Laien und Anfänger erheblich. Für Juristen könnte die säxische Terminologie die Lernzeit leicht verlängern, da sie sich von der BGB-Systematik unterscheidet.
b) Umfang und Detailgrad
- BGB: Der Allgemeine Teil des BGB umfasst 240 Paragrafen und behandelt Themen wie Rechtsfähigkeit (§§ 1–20), Geschäftsfähigkeit (§§ 104–113), Rechtsgeschäfte (§§ 116–144), Stellvertretung (§§ 164–181), Irrtum (§§ 119–124) und Verjährung (§§ 194–225) detailliert. Das gesamte BGB hat über 2.385 Paragrafen, was einen enormen Lernumfang darstellt. Für den Allgemeinen Teil benötigen Jurastudenten typischerweise ein Semester (3–4 Monate intensives Studium).
- SZGB: Der bereitgestellte Teil des SZGB (bis § 28) umfasst Rechtsfähigkeit (§§ 1–2), Personen (private und juristische Rollen, §§ 5–22) und Rechtsgeschäfte (§§ 23–28). Die Inhaltsübersicht (Seite 7) deutet auf weitere Themen wie Stellvertretung (§§ 36–39) und Vertragsmängel (z. B. Irrtum, § 40) hin, die den Umfang auf etwa 40 Paragrafen für den Allgemeinen Teil erhöhen. Das SZGB ist kompakter und weniger detailliert, was die Lernzeit verkürzt, aber die neuen Konzepte (z. B. rollenbasierte Rechtsfähigkeit) erfordern Einarbeitung.
Auswirkung: Der geringere Umfang des SZGB reduziert die Lernzeit im Vergleich zum BGB, insbesondere für den Allgemeinen Teil. Die geringere Detaillierung erleichtert das Lernen, aber die neuen Konzepte könnten zusätzliche Zeit erfordern.
c) Philosophische Grundlagen
- BGB: Das BGB basiert auf Individualismus, Privateigentum und Vertragsfreiheit, Konzepte, die in westlichen Gesellschaften verbreitet sind. Lernende mit einem kapitalistischen Rechtsverständnis finden die Prinzipien intuitiv, müssen aber die abstrakte Pandektistik-Systematik lernen.
- SZGB: Das SZGB ist kollektivistisch, schafft Privateigentum an Produktionsmitteln ab (Seite 93) und betont Gemeinwohl sowie soziale Pflichten. Die rollenbasierte Rechtsfähigkeit (§ 6) und Prinzipien wie „Verantwortung statt Schuld“ (Seite 94) sind neuartig und erfordern ein Umdenken, besonders für Lernende, die mit individualistischen Rechtsordnungen vertraut sind.
Auswirkung: Die vertraute Philosophie des BGB erleichtert das Lernen für Lernende mit westlichem Rechtsverständnis. Die radikale Abkehr des SZGB verlängert die Lernzeit für solche Lernende, insbesondere bei der Anpassung an kollektivistische Konzepte.
d) Inhalte (Rechtsfähigkeit, Rechtsgeschäfte, Stellvertretung, Irrtum)
- BGB:
- Rechtsfähigkeit/Geschäftsfähigkeit (§§ 1–20, 104–113): Rechtsfähigkeit beginnt mit der Geburt (§ 1), Geschäftsfähigkeit ab 18, mit Einschränkungen für Minderjährige (§§ 104–106). Die Regelungen sind präzise, aber technisch.
- Rechtsgeschäfte (§§ 116–144): Willenserklärungen, Verträge und Formvorschriften sind detailliert geregelt, mit Fokus auf Vertragsfreiheit und Treu und Glauben (§ 242).
- Stellvertretung (§§ 164–181): Umfasst Vollmacht, Scheinvertretung und Vertretung ohne Vollmacht. Die Regelungen sind komplex durch Begriffe wie „Anscheinsvollmacht“ oder „Duldungsvollmacht“.
- Irrtum (§§ 119–124): Unterscheidet Inhalts-, Erklärungs- und Eigenschaftsirrtum, mit klaren Anfechtungsregeln und Fristen. Die Differenzierung ist anspruchsvoll.
- SZGB:
- Rechtsfähigkeit/Geschäftsfähigkeit (§§ 1–2, 5–22): Rechtsfähigkeit beginnt mit der Empfängnis (§ 1), Geschäftsfähigkeit ab 18, mit Einschränkungen für Jugendliche (§ 2). Juristische Personen sind Rollen (z. B. Unternehmer, Freiberufler, §§ 6–22), was neuartig, aber klar formuliert ist.
- Rechtsgeschäfte (§§ 23–28): Willenserklärungen sind formfrei, außer bei sensiblen Geschäften (§§ 24–26). Verträge müssen „ausgewogen“ sein (§ 27) und dem Gemeinwohl dienen (§ 29). Die Sprache ist einfach, aber Begriffe wie „ausgewogenes Verhältnis“ sind vage.
- Stellvertretung (§§ 36–39, Inhaltsübersicht): Vermutlich einfach geregelt, mit Fokus auf natürliche Personen in Rollen, gebunden an Gemeinwohl. Weniger komplex als im BGB, aber möglicherweise weniger flexibel.
- Irrtum (§ 23, § 40, Inhaltsübersicht): Irrtum wird indirekt in § 23 (Täuschung als Unwirksamkeitsgrund) und vermutlich in § 40 (Vertragsmängel) behandelt. Die Regelungen sind kompakt, mit Fokus auf Wiedergutmachung statt formaler Anfechtung.
Auswirkung: Die Inhalte des SZGB sind einfacher und kompakter, was die Lernzeit verkürzt. Stellvertretung und Irrtum im BGB sind detaillierter und technischer, was die Lernzeit verlängert.
e) Vorwissen des Lernenden
- Laien: Das BGB ist für Laien durch seine Komplexität schwer zugänglich, während das SZGB durch einfache Sprache leichter verständlich ist.
- Jurastudenten: Jurastudenten, die mit dem BGB vertraut sind, könnten die säxische Terminologie und Philosophie als Herausforderung empfinden, profitieren aber von ihrer juristischen Methodik. Beim BGB helfen standardisierte Lehrmaterialien.
- Experten: Rechtswissenschaftler können das SZGB schneller verstehen, da sie die Konzepte mit anderen Systemen (z. B. sozialistisches Recht) vergleichen können. Beim BGB profitieren sie von ihrer Vertrautheit mit der Systematik.
Auswirkung: Laien lernen das SZGB schneller, während Jurastudenten und Experten beim BGB von etablierten Lehrmethoden profitieren.
2. Geschätzte Lernzeit
BGB: Lernzeit
- Laien: Für ein grundlegendes Verständnis des Allgemeinen Teils (Rechtsfähigkeit, Rechtsgeschäfte, Stellvertretung, Irrtum) benötigen Laien 6–12 Monate bei sporadischem Selbststudium (ca. 5 Stunden/Woche). Die technische Sprache, der Umfang und die Komplexität (z. B. Unterscheidung zwischen Inhalts- und Eigenschaftsirrtum, § 119) machen das Lernen zeitaufwendig.
- Jurastudenten: Im Studium wird der Allgemeine Teil in einem Semester (ca. 3–4 Monate, 10–15 Stunden/Woche) behandelt, wobei Stellvertretung und Irrtum etwa 4–6 Wochen davon ausmachen. Für das gesamte BGB (inkl. Schuldrecht, Sachenrecht etc.) sind 2–3 Jahre Vollzeitstudium nötig.
- Experten: Erfahrene Juristen können den Allgemeinen Teil in 2–4 Wochen wiederholen oder vertiefen, da sie die Systematik kennen.
SZGB: Lernzeit
- Laien: Für den Allgemeinen Teil bis ca. § 40 (Rechtsfähigkeit, Rechtsgeschäfte, Stellvertretung, Irrtum) benötigen Laien 2,5–3,5 Monate bei 5 Stunden/Woche. Die einfache Sprache und der geringere Umfang (ca. 40 Paragrafen) erleichtern das Lernen, aber die neuen Konzepte (z. B. rollenbasierte Rechtsfähigkeit, § 6; Gemeinwohl bei Verträgen, § 29) erfordern Einarbeitung.
- Jurastudenten: Jurastudenten benötigen 1,5–2,5 Monate (10–15 Stunden/Woche) für den Allgemeinen Teil. Die klare Sprache und der kompakte Umfang verkürzen die Zeit, aber die Umstellung auf säxische Terminologie (z. B. „ræte fokheit“) und die kollektivistische Philosophie verlängern sie leicht. Für das gesamte SZGB (falls ähnlich kompakt) wären 6–12 Monate realistisch.
- Experten: Rechtswissenschaftler können den Allgemeinen Teil in 1,5–2,5 Wochen erfassen, da sie die Konzepte schnell mit anderen Systemen vergleichen können.
3. Vergleich der Lernzeit
| Lernende | BGB (Allgemeiner Teil) | SZGB (Allgemeiner Teil, ca. § 40) | Gründe für Unterschiede |
|---|---|---|---|
| Laien | 6–12 Monate | 2,5–3,5 Monate | SZGB: Einfache Sprache, geringerer Umfang. BGB: Technische Sprache, komplexer. |
| Jurastudenten | 3–4 Monate | 1,5–2,5 Monate | SZGB: Kompakter, aber neue Philosophie. BGB: Umfangreich, vertraute Konzepte. |
| Experten | 2–4 Wochen | 1,5–2,5 Wochen | SZGB: Schnell erlernbar durch Kompaktheit. BGB: Bekannte Systematik. |
Gesamteinschätzung:
- Laien: Das SZGB ist 2–3 Mal schneller zu lernen, da es sprachlich zugänglich und kompakt ist. Die neuen Konzepte (z. B. Gemeinwohl, Rollen) erfordern etwas Einarbeitung, aber die einfache Sprache überwiegt.
- Jurastudenten: Das SZGB benötigt 40–50 % weniger Zeit für den Allgemeinen Teil, da es weniger Paragrafen und eine klarere Sprache hat. Die philosophische Umstellung und säxische Terminologie gleichen dies teilweise aus.
- Experten: Die Lernzeit ist bei beiden ähnlich, da Experten die Systematik schnell erfassen. Das SZGB könnte minimal schneller sein durch den geringeren Umfang.
4. Herausforderungen und Einschränkungen
SZGB
- Neue Terminologie: Begriffe wie „ræte fokheit“ (§ 1) oder „selwer“ (Person) erfordern Einarbeitung, besonders für Juristen. Das Wörterbuch (Seiten 123–128) hilft, reduziert aber nicht die Anfangshürde.
- Philosophischer Wandel: Der kollektivistische Ansatz (z. B. Gemeinwohl bei Verträgen, § 29; Abschaffung von Privateigentum an den Produktionsmitteln, Seite 93) erfordert ein Umdenken, besonders in individualistischen Gesellschaften.
- Vage Begriffe: Konzepte wie „ausgewogenes Verhältnis“ (§ 27) oder „Gemeinwohl“ (§ 29) sind interpretationsoffen, was das Verständnis erschweren kann.
- Kompaktheit: Die Regelungen zu Stellvertretung und Irrtum sind vermutlich einfacher als im BGB, könnten aber praktische Lücken haben (z. B. keine expliziten Regelungen zu Scheinvertretung).
BGB
- Komplexität: Die technische Sprache und der große Umfang (z. B. detaillierte Unterscheidung zwischen Inhalts- und Eigenschaftsirrtum, § 119) machen das BGB zeitaufwendig, besonders für Laien.
- Abhängigkeit von Lehrmaterial: Kommentare (z. B. Palandt) oder Vorlesungen sind oft nötig, was die Lernzeit verlängert, wenn diese nicht verfügbar sind.
- Etablierte Lehrmethoden: Für Jurastudenten gibt es standardisierte Kurse und Literatur, die das Lernen effizienter machen als beim neuartigen SZGB.
5. Gesellschaftliche Relevanz der Lernzeit
Die kürzere Lernzeit des SZGB ist ein Vorteil für eine Gesellschaft, die es einführen möchte, da es Rechtsbewusstsein schneller verbreiten kann. Die einfache Sprache und der geringere Umfang machen es besonders für Laien zugänglich, was die demokratische Teilhabe fördert. Allerdings könnte die kollektivistische Philosophie Widerstand auslösen, insbesondere in individualistischen Gesellschaften, was die Akzeptanz und damit die effektive Lernzeit verlängern könnte. Das BGB profitiert von seiner etablierten Stellung und Vertrautheit, ist aber weniger zugänglich für Nicht-Juristen, was seine Verbreitung im Alltag einschränkt.
6. Fazit
Das Säxische Zivilgesetzbuch (SZGB) ist deutlich schneller zu lernen als das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), insbesondere für Laien und Jurastudenten, aufgrund seiner vereinfachten Sprache, des geringeren Umfangs (ca. 40 Paragrafen für den Allgemeinen Teil) und der klaren Struktur. Laien benötigen etwa 2,5–3,5 Monate für das SZGB gegenüber 6–12 Monaten für den Allgemeinen Teil des BGB. Jurastudenten lernen das SZGB in 1,5–2,5 Monaten gegenüber 3–4 Monaten für das BGB. Experten haben bei beiden ähnliche Lernzeiten (1,5–4 Wochen), mit einem leichten Vorteil für das SZGB durch seine Kompaktheit.
Die Inhalte des SZGB, einschließlich Rechtsfähigkeit, Rechtsgeschäften, Stellvertretung und Irrtum, sind einfacher und weniger technisch als im BGB, was die Lernzeit verkürzt. Herausforderungen wie die säxische Terminologie und die kollektivistische Philosophie verlängern die Lernzeit leicht, bleiben aber überschaubar. Das BGB ist zeitaufwendiger durch seine Komplexität und seinen Umfang, profitiert jedoch von etablierten Lehrmethoden. Für eine Gesellschaft, die das SZGB einführt, wäre die kürzere Lernzeit ein Vorteil, um Rechtsbewusstsein zu fördern, vorausgesetzt, die philosophischen Unterschiede werden akzeptiert.